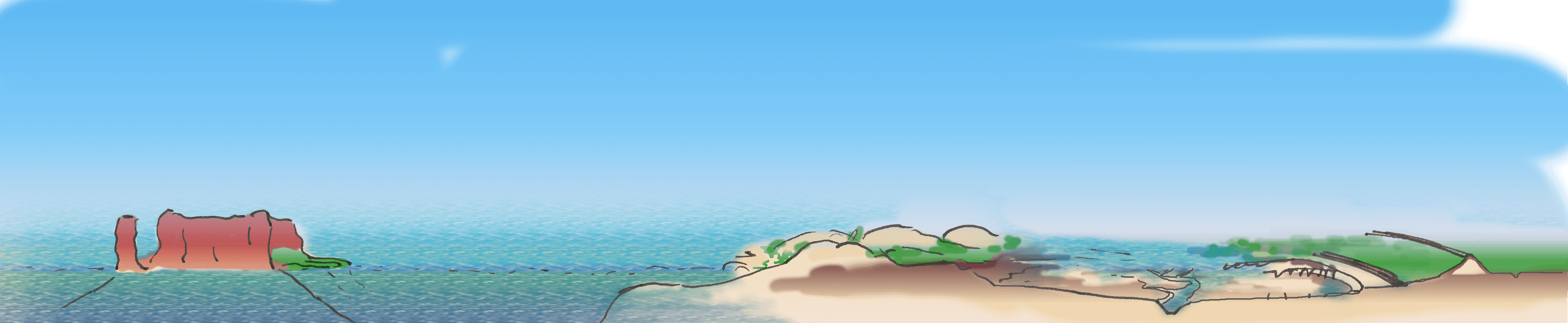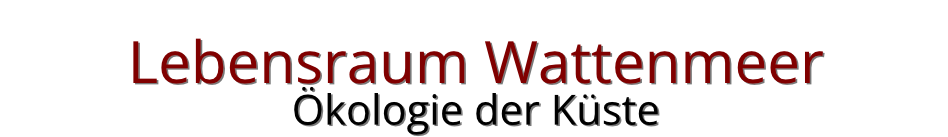Schlickwatt
Wenn Urlauber an die Wattwanderung zurückdenken, fällt vielen zuerst der Schlick ein, in dem sie „fast“ stecken geblieben sind – oder doch zumindest die Stiefel. Natürlich ist ernsthaft noch keiner endgültig stecken geblieben, die meisten Schlickwatten sind nicht allzutief – in 20 – 40cm Tiefe verfestigt sich der Boden wieder. Bestimmt aber mussten schon zahlreiche Stiefel zurückgelassen werden. Was hat es mit dem Schlickwatt auf sich?


Insbesondere bei Wattführungen vom Festland aus müssen häufig längere Wegstrecken zurückgelegt werden, bevor die Wattwandergruppe auf festeren, sandigeren Boden gelangt. Der Meeresboden ist also gerade zur Küste hin und in Lee von Inseln und Halligen (meiste an deren Ostseite, an der der Wellenschlag nicht so stark ist) schlickig und schlüpfrig. Die dunkelgraue Farbe verrät, dass trotz längerer Trockenzeit (die Flächen liegen höher) wenig Sauerstoff im Boden ist.
Trotzdem ist das Schlickwatt ein dicht besiedelter Lebensraum. Der Anteil von organischer Masse kann 6 mal so hoch sein wie im Sandwatt. Wie ist das möglich?
Merkmale & Entstehung
Das Schlickwatt unterscheidet sich physikalisch vom Sand- und Mischwatt durch Korngröße des Bodens und Wassergehalt:
- besteht aus sehr feinem Sand und organischen Bestandteilen mit einer Korngröße unter 0,06 mm
- hoher Bodenwassergehalt von 50-70 %, man sinkt leicht ein
- Anteil der organischen Substanz ist mit 10% relativ hoch
→ das entspricht 1,4kg/m2 Fläche bzw. 14t/ha
Von der kleinen Wattschnecke sind schon bis zu 100.000 Individuen/m2 gezählt worden. - Die pflanzliche Produktion des Schlickwatts liegt in etwa auf der Höhe von Kulturland (300 – 400 g CO2/m2/Jahr)(!) (nach Kock)
- Damit ist der graue Schlick-Boden einer der lebendigsten Lebensräume der Erde
Die Ursache liegt vor allem in der Entstehung des Schlicks: Er befindet sich vor allem in strömungsberuhigten Küstenbereichen – und die neben den oben genannten natürlichen Gründen auch durch den Menschen mittels Lahnungen (in das Meer reichende „Holzzäune“) künstlich geschaffen werden.
Wenig Strömung bedeutet, dass besonders viel Detritus (organisches Totmaterial) und Plankton (tierische und pflanzliche Kleinstlebewesen) absinken können. Auf der Oberfläche befindet sich eine üppige Kieselalgendecke. Davon können sich wiederrum unzählige Schnecken und Muscheln ernähren.
Die Bewohner
Insbesondere leben im Schlickwatt: die kleine (oder gemeine) Wattschnecke (Hydrobia ulvae), die Pfeffermuschel (Scrobicularia plana) und der Kotpillenwurm (Heteromastus) – (auch „Gummibandwurm“, da er stark dehnbar ist) – sowie die auch im Mischwatt vorkommenden Opalwurm (Nephtys hombergii), Seeringelwurm (Nereis diversicolor) und junge Wattwürmer (Arenicola marina) – (die älteren Tiere ziehen das Misch- und Sandwatt vor. An Muscheln findet man die „baltische“ Plattmuschel (Macoma baltica) – (die trotz ihres Namens auch in der Nordsee vorkommt) und schließlich der Schlickkrebs (Corophium volutator), der das Knistern erzeugt, dass man im Watt hören kann: er spreizt seine beiden Fühler – und dabei platzt das Wasserhäutchen dazwischen. Wenn das ganz viele Krebschen machen (und bis zu 5000 können auf einem Quadratmeter Watt leben), dann knistert es deutlich vernehmbar.



Abb. 3: a) Der Schlickkrebs (Corophium volutator) (Film) mit seinem kräftigen paar Antennen, 9mm Größe. Die charakteristische Fortbewegung ist in einer Filmsequenz zu sehen
b) Die kleine Wattschnecke (Hydrobia ulvae) auf Halligflieder
c) Queller (Salicornia europaea) besiedelt küstennahes Schlickwatt als Erster. Darauf sitzt wieder die kleine Wattschnecke
d) Queller im Herbst
Das Schlickwatt geht küstenwärts in das Land über. Sogenannte „Pionierpflanzen“ besiedeln diesen sehr salzigen und unruhigen Lebensraum, das ist im Wattenmeer vor allem der Queller (Salicoria europaea). Er wird genauer vorgestellt im Bereich Vorland & Salzwiesen.